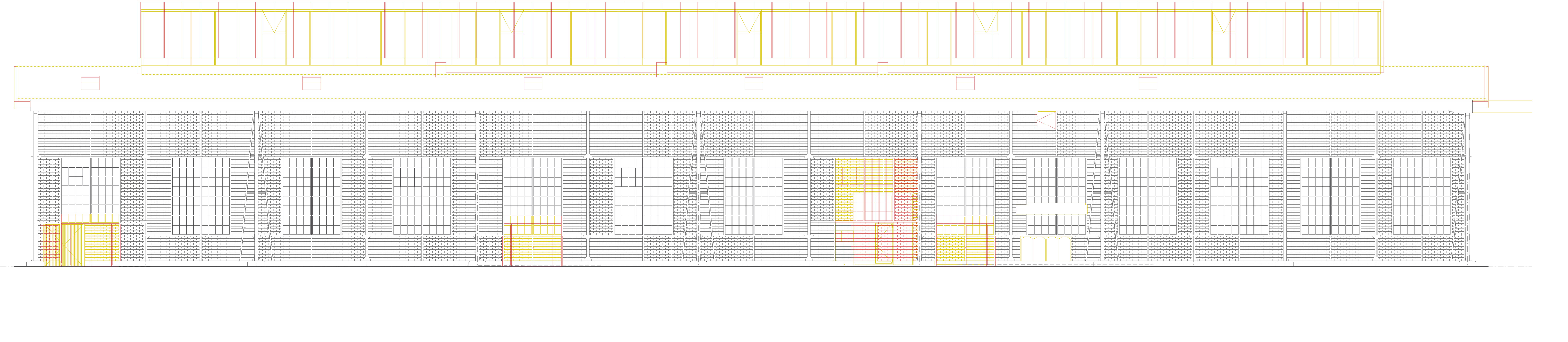«Mit den Spuren des Gebrauchs umgehen»
Interview mit den Architekten von giuliani.hönger zum Umbau der Weichenbauhalle auf dem Von-Roll-Areal in Bern
Eine Fassade erzählt ihre Geschichte: Die 2010 abgeschlossene Umnutzung der Weichenbauhalle in Bern ist ein Beispiel für die interpretierende Rekonstruktion einer Gebäudehülle. Die mit der Planung betrauten Zürcher Architekten giuliani.hönger haben Einschalenmauerwerk aus Zementstein freigelegt und Spuren der Veränderung sichtbar belassen. Für den Erhalt der Mauerwerks-fassade war ein beinahe archäologischer Umgang mit dem Bestand erforderlich. Dazu zählte auch die Rekonstruktion von Teilen der Fassade sowie die dafür nötige Reproduktion des verwendeten Zementsteins.
TEC21: Beim Umbau der Weichenbauhalle auf dem Von-Roll-Areal in ein Hörsaalgebäude für die Uni Bern haben Sie sich dafür entschieden, die äussere, einschalige Mauerwerkshülle instand zu setzen. Es ist ungewöhnlich, eine solche Fassade in ihrem Zustand zu belassen und ungedämmt für eine Neunutzung zu erhalten. Wie kam es dazu?
Lorenzo Giuliani: Die städtebauliche Ausgangslage, unsere Grundidee beim Wettbewerb für das Gesamtareal, hatte bereits Einfluss auf die konstruktiven Entscheidungen. Wir wollten die beiden alten Hallen die ehemalige Kraftzentrale und die Weichenbauhalle erhalten, um den Charakter des Ortes zu wahren. Auch die Gebäudehülle der Neubauten sollte in einem Stein ausgeführt werden, der die Ensemblewirkung unterstützt und mit dem Bestand einen Dialog eingeht.
Christian Hönger: Den Erhalt der Hülle ermöglichte der Nutzungsentscheid der Bauherrschaft. Im Wettbewerb war gefordert, eine Bibliothek in der Halle unterzubringen. Damit wäre eine innenseitige Dämmung notwendig geworden. Schliesslich sollten aber die Hörsäle in das Zentrum der Anlage. Wir haben die Einbauten, die die Hörsäle aufnehmen, gedämmt und beheizt ausgeführt. Der Raum zwischen Einbauten und Hülle wird nur passiv erwärmt. So konnten wir die ungedämmte einschalige Wandkonstruktion erhalten. Das war nur möglich, weil die Bauherrschaft diesen Entscheid mitgetragen hat.
Das heisst, man akzeptiert im Zwischenraum grössere Temperaturschwankungen?
C. H.: Ja, das Innenraumklima ähnelt dem der früheren Werkhallen es wird nicht auf die heute üblichen 2022 °C aufgeheizt. Da die Bereiche mittels Abwärme aus der Kälteerzeugung temperiert werden, fällt dort die Temperatur im Winter aber nicht unter 15°C. Für die Denkmalpflege war dies ein Glücksfall.
War Ihnen sofort klar, dass Sie die Hülle auch innen erhalten wollten? Oder kam diese Idee im Rahmen des Austauschs mit der Denkmalpflege?
L. G.: Es war ein Teil unseres Konzeptes, die Materialität der Hülle nicht zu verändern oder einzupacken auch nicht im Inneren.
Julia Koch: Die Halle zu erhalten, war unser Vorschlag. Die Bauten waren von der Denkmalpflege als erhaltenswert eingestuft. Das heisst, man konnte im Wettbewerb vorschlagen, sie abzureissen, aber wenn man sie erhalten wollte, musste man mit der Denkmalpflege zusammenarbeiten.
C. H.: Wir fanden die Transformation von einem Industrieareal zu einer Denkfabrik interessant. Es gibt eine Stimmung, die kein Neubau erreichen kann. Es ist auch ein Gefühl der Geschichte. Sie ist inhärent.
L. G.: Was die Halle auch interessant macht, ist ihre relativ kräftige Primärstruktur. Dadurch ist sie in der Nutzung flexibel. Das kam uns entgegen: Es war eine Forderung der Bauherrschaft, flexible Strukturen anzubieten, die in 20 oder 30 Jahren dann auch wieder Änderungen zulassen, ohne dass die Raumstruktur infrage gestellt wird. Es gab also so etwas wie eine übergeordnete Logik, die es ermöglichte, die Struktur der Öffnungen und die Materialität des Hörsaalgebäudes zu erhalten.
Wie sind Sie in der Planung weiter vorgegangen? Zu welchem Zeitpunkt erfolgte die Analyse des Mauerwerks, und wie sind Ihre Handlungsentscheide daraus abgeleitet?
L. G.: Es war ein relativ langer Prozess in permanenter Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege. Wir haben die Halle im Zustand einer hundertjährigen Nutzung vorgefunden, es waren überall Spuren dieser langjährigen Nutzung zu sehen. Die Halle war eingebaut, ihr Volumen nicht wahrnehmbar, Fassadenteile waren überstrichen, Stahlteile und das Oberlicht ausgetauscht. Aus bautechnischer Sicht war sie allerdings in einem sehr guten Zustand. Der Stahlbau, die Tragkonstruktion, war sehr gut erhalten, hier musste lediglich der Korrosionsschutz erneuert werden. Das Mauerwerk haben wir nur mit Wasser gereinigt. Entscheidend war, wie wir mit den Spuren des Gebrauchs umgehen sollten: Es hatte unterschiedliche Zwischennutzungen gegeben. In den 1980er-Jahren war ein Autohaus in der Halle. Im Laufe dieser Nutzung wurden Teile der Fassade herausgebrochen; damit ergaben sich Verletzungen der Struktur. Wir trafen den Entscheid solche Verletzungen wieder rückzubauen. Alle anderen Eingriffe sind innerhalb der alten Struktur erfolgt.
Wie sahen diese Eingriffe aus?
J. K.: Aus dem Wegsystem des Campus heraus mussten wir die Bewegungsrichtung im Gebäude um 90 Grad drehen die Halle quer durchwegen. Das heisst, wir brauchten die Tore an den Stirnseiten nicht mehr als Zugänge. Für die neuen Zugänge haben wir einzelne Fensterachsen an den Längsseiten bis auf den Boden geführt. Dazu wurde das vorhandene Stahlprofil nach unten verlängert und das Mauerwerk herausgebrochen. Es war uns wichtig, das Material, das wir weggenommen hatten, weiter zu nutzen. Man konnte daher den Abbruch nicht mit grobem Gerät vornehmen. Er war Feinstarbeit, die einzelnen Steine wurden vom Mörtel befreit, sodass man sie wieder einbauen konnte. Da die Steine aus dem Abbruch aber nicht ausreichten, mussten wir einen neuen Stein entwickeln, mit dem wir die übrigen Lücken schliessen konnten.
Es gab also zwei Arten von Reparaturen an der Fassade?
C. H.: Bei kleinen Reparaturen, vor allem bei den Stellen, wo es sehr aufgefallen wäre, mit einem neuen Stein zu arbeiten, haben wir den alten verwendet. Bei den grösseren Feldern, die ganz neu gemauert werden mussten, haben wir den neuen Zementstein eingesetzt, den wir mit dem Baumeister entwickelt hatten. Ausgangspunkt dabei war die Untersuchung des auf dem Areal verwendeten Mauersteins. Der Zement im Bestandsmauerwerk ist 100 Jahre alt. Wir hatten zunächst keine Ahnung, wie er sich zusammensetzt. Wir haben damit angefangen, einen normalen Zementstein produzieren zu lassen. Er war zu grau und in der Farbwirkung viel zu kalt der alte Stein hat einen warmen Farbton.
Gab es Laboruntersuchungen des Steins, oder erfolgte die gestalterische Angleichung nur durch Versuche?
J. K.: Die Unternehmung, die die Steinproben erstellte, hat im Auftrag des Baumeisters den Stein untersucht und gelblichen Jurasand darin gefunden. Die Farbigkeit des neuen Steins entsteht also nicht durch ein Pigment, sondern durch das Material. Das war wichtig in Hinblick auf die Alterung. Auch die Oberflächenbehandlung war ein Thema. Soll der Stein künstlich bewittert werden, um ihn an den Bestand anzupassen? Wir haben Versuche gemacht den Stein sandgestrahlt und gesäuert , dann aber entschieden, ihm Zeit zu geben zu altern. Ebenso haben wir die Fugen nicht geschwärzt. Man darf sehen, was ergänzt ist, ähnlich wie bei einer Holzbank, bei der man eine Latte erneuert.
Wie wurde der Stein produziert, und wie lange hat es gedauert, bis Sie die Zusammensetzung herausgefunden haben?
J. K.: Er wurde in Kleinserie von 1500 Steinen produziert. Der Prozess dahin hat einige Zeit gedauert. Wir haben eineinhalb Monate lang wöchentlich neue Muster begutachtet.
War die Ertüchtigung des Tragwerks hinsichtlich Erdbebensicherheit ein Thema?
L. G.: Die grossen Fassadenflächen gewährleisten, in Verbindung mit der als Scheibe ausgebildeten Dachstruktur, die Erdbebensicherheit der bestehenden Halle. Im Inneren übernehmen die neuen Erschliessungskerne diese Aufgabe.
Die neuen Fenster sind das einzige von aussen unmittelbar sichtbare Zeichen des Eingriffs. Wie kam es dazu?
C. H.: Die bestehenden Fenster sind innen angeschlagen. Es war der Denkmalpflege ein Anliegen, diese Fenster zu erhalten. Die bestehende Verglasung spiegelt die hundertjährige Geschichte der Halle. Es gibt tatsächlich noch erhaltene Gläser der Originalfenster. Allerdings kann man die alten Profile feine Gussrahmen nicht nachträglich dämmen. Wir haben aus energetischen Gründen die neuen Fenster in die Zarge eingesetzt, also in die alte Stahlstruktur. Es sind sehr grosse Flächen, das heisst, wir konnten den Wert der Fassade deutlich verbessern, indem wir allein die Fensterflächen optimiert haben. Auch diese Lösung wurde in enger Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege entwickelt. Die Elemente haben zudem einen integrierten Sonnenschutz, um im Sommer eine Überhitzung des Innenraums zu verhindern.
L. G.: Wir wollten, dass man die alten Sprossenfenster von aussen durch die Verglasung hindurch sieht. Das war auch der Denkmalpflege ein Anliegen. Frontal sieht man die Sprossenverglasung, und es gibt durch den Lichteinfall in den Zwischenräumen schöne Zeichnungen in der Halle. Der Schattenwurf bildet die unterschiedlichen Glasarten ab.
Es scheint, als wären bei den Fenstern die Vorgaben der Denkmalpflege schwierig zu erfüllen gewesen. Haben Sie dies nicht als Einschränkung empfunden?
C. H.: Ich finde, die Frage müsste lauten: «Was ist neu, und was bleibt » Wir fanden diesen Ansatz anregend und haben ihn nicht nur als Vorgabe aufgefasst. Die Denkmalpflege hat uns zum Beispiel wirklich geknebelt, die Rahmen der neuen Fenster schmal zu halten. Aber wir müssen das Ganze technisch verantworten. Es ist also immer auch ein Ausloten der Grenzen des Möglichen. Manchmal braucht man auch den Gegenspieler, um so weit zu kommen.
Die Türen waren nicht alle erhalten. Haben Sie die fehlenden nachgebaut?
L. G.: Wir haben uns bei den neuen Toren an den bestehenden alten orientiert. Die Blechverkleidung des mittleren Tors war sogar noch gelagert, sodass wir sie wiederverwenden konnten. Bei den neuen Toren haben wir jedoch nicht versucht, die alten Wellblechtore zu imitieren. Wir haben für die neuen glattes Stahlblech verwendet, um auch hier nicht einfach ein Bild zu kopieren. Mit dem Oberlicht verhält es sich ähnlich: Es musste ganz andere technische Anforderungen erfüllen als das alte. Wir wollten, dass das neue in der Erscheinung dem alten nahekommt, aber es ist technisch komplexer, gewährleistet auch den Sonnenschutz und die Tageslichtkontrolle für die Innenräume.
Und die Dachkonstruktion? Die Tragstruktur ist erhalten, aber der Aufbau?
C. H.: Die Füllungen haben wir ersetzt, auch um den Energienachweis zu erfüllen. Wir mussten das Dach erneuern, es war in einem ziemlich schlechten Zustand. Auch vom Oberlicht war praktisch nichts mehr vorhanden. Das gab uns auch die Möglichkeit, es wieder in enger Abstimmung mit der Denkmalpflege neu zu machen. Dabei war es eine Herausforderung, das Erscheinungsbild nach aussen zu wahren. Mit dem neuen Dachaufbau, der deutlich höher ist als der alte, wäre auch der Dachrand massiver ausgefallen. Auf diesen Industriebauten liegen aber keine dicken Dächer, das sind schlanke Konstruktionen. Daher haben wir die Dachaufbauten zum Rand hin verjüngt.
Sie haben eine Schadenskarte erstellt? Wie war die Umsetzung?
J. K.: Wir haben jeden Einzelfall betrachtet. Wichtig war es, die Massnahmen einzeln zu interpretieren. Dies war aufwendig, auch weil die ausführenden Handwerker zunächst pragmatisch vorgehen. Das heisst, sie mörteln kleinere Fehlstellen aus, weil es schneller geht. Zu erklären: Nehmt bitte einen Stein vom Abbruch, passt ihn gegebenenfalls an und setzt ihn wieder ein, war zunächst mühsam. Aber unser Baumeister und der Polier waren sehr engagiert und haben unser Vorgehen mitgetragen. Es war eine schöne Erfahrung, dass die Unternehmer diese Herangehensweise unterstützt haben.
Am Bau Beteiligte
Bauherrschaft
Kanton Bern, Amt für Grundstücke und Gebäude (AGG)
Architektur
giuliani.hönger, Zürich
Projektleitung
Julia Koch (ab 2008)
Gabriele Oesterle (bis 2008)
Tragkonstruktion
Dr. Schwarz Consulting, Zug
HLKS-Planung
Amstein + Walthert, Bern
Baumanagement
b + p baurealisation, Zürich
Bauleitung
Eberhart Bauleitungen, Bern
Bauphysik / Akustik
Bakus Bauphysik, Zürich
Denkmalpflege
Denkmalpflege der Stadt Bern, Bern
Fassadenplanung
gkp fassadentechnik, Aadorf
Holzbau
Walter Bieler AG, Bonaduz
Kosten- und Terminplanung
b + p baurealisation ag / Eberhart Bauleitungen AG, Bern
Lichtplanung
Vogt & Partner, Winterthur
Beratung Minergie-Eco
Bau- und Umweltchemie, Zürich
Brandschutz
Makiol + Wiederkehr, Beinwil am See
Fassadensanierung
Baumeister
Burn & Künzi AG, Oey
Zementstein
Creabeton, Einingen