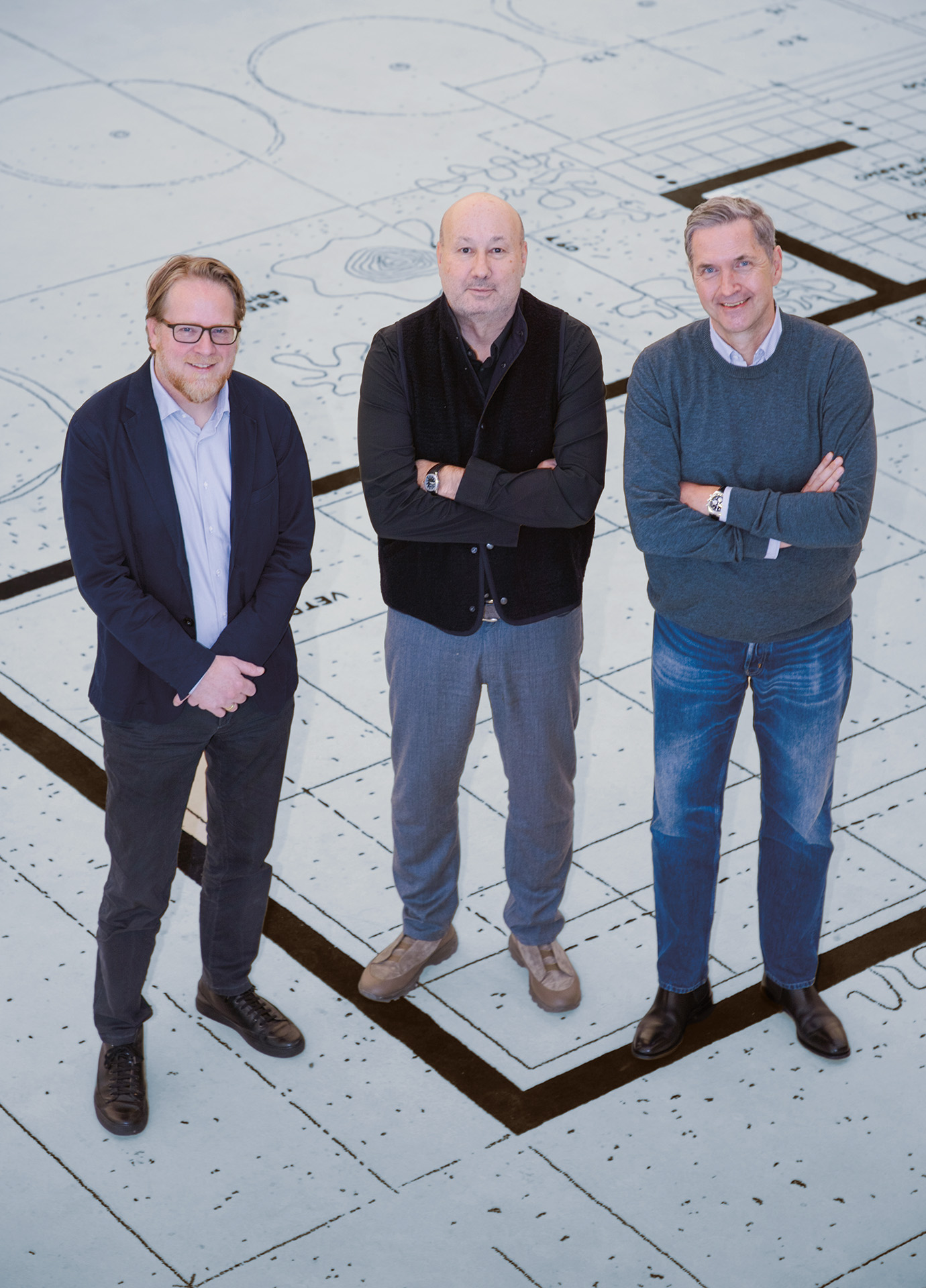«Wissenstransfer ist die Königsdisziplin»
Future Cities Laboratory
Weshalb stellt sich Future Cities Laboratory der Komplexität des Urbanen? Die drei Direktoren erläutern im Gespräch, was sie täglich motiviert – und herausfordert.
Future Cities Laboratory (FCL) ist eine Kooperation zwischen der ETH Zürich und den drei Universitäten NUS, NTU und SUTD in Singapur, die gemeinsam die Entwicklung nachhaltiger Siedlungsstrukturen erforschen. Wichtig ist auch der Transfer in die Praxis: Die Ergebnisse sollen neben dem wissenschaftlichen auch einen direkten praktischen Mehrwert generieren. Weshalb der Praxisbezug?
Sacha Menz: Die Zeit drängt. Globale Krisen – Klimawandel, Artensterben, soziale, ökonomische, politische Konflikte – nehmen zu; wir müssen den Wandel zu einer nachhaltigen Entwicklung schaffen, bevor der Kipppunkt erreicht ist. Dafür reicht keine Theorie, wenn sie nicht wirkungsvoll umgesetzt wird.
Die FCL-Module vermitteln ein Verständnis von komplexen Zusammenhängen und erarbeiten innovative, praxistaugliche Instrumente. Dazu gehören etwa neue Betrachtungsweisen sowie Modelle und Tools für die Erfassung, die Analyse und Auswertung von Daten, insbesondere für datenbasierte und wissenschaftlich belastbare Prognosen. Diese ermöglichen es Entscheidungsträgern, Ressourcen zu priorisieren und optimal einzusetzen, um nachhaltige, lebenswerte Siedlungsstrukturen zu fördern.
Weshalb braucht es dafür transdisziplinäre Forschungsteams wie in den FCL-Modulen?
Arno Schlüter: Siedlungsstrukturen sind komplexe Systeme, geprägt von ebenso komplexen Fragestellungen, mit einer Vielzahl von Akteurinnen und Akteuren, Abhängigkeiten, Zielkonflikten sowie widersprüchlichen Randbedingungen und Dynamiken. Darauf gibt es keine einfachen Antworten. Entscheidend für eine nachhaltige Entwicklung ist allerdings diese umfassende Betrachtung. Die Grundlage ist ein holistischer, transdisziplinärer, für spezialisierte Fachleute oft ungewohnter und deshalb umso wertvollerer Blick auf die Stadt. Erst dieser öffnet neue Perspektiven.
Die Standorte Zürich und Singapur weisen unterschiedliche kulturelle, ökonomische, politische und klimatische Bedingungen auf. Die Forschenden fokussieren auf den jeweiligen Kontext, gewinnen aber auch übergeordnete Erkenntnisse. Wie erfolgt der Wissenstransfer in die Praxis?
S.M.: Von unseren vier Standbeinen – Science, Design, Engineering und Governance – ist letztere die Königsdisziplin. Der Transfer von Forschungsergebnissen in die Politik und die Behörden ist herausfordernd. Gesetzgebung und Normierung – Policy Making – sind nicht Aufgabe der Wissenschaft. Aber wir wollen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger unterstützen; unsere Konzepte und Tools können ihnen Orientierung und praktische Hilfe geben. Deswegen suchen wir den Kontakt mit Behörden.
In der Schweiz tauschen wir uns mit der Direktion des Bundesamts für Raumentwicklung, aber auch mit kantonalen und kommunalen Planungsämtern aus. Auftragsforschung betreiben wir nicht, aber einige unserer Projekte in der Schweiz führen wir in Zusammenarbeit mit Ämtern durch. Einen intensiven Dialog pflegen wir mit der Stadt Zürich, wo sich die ETH befindet. Das gegenseitige Interesse ist gross, weil auf beiden Seiten viel wertvolles Wissen vorhanden ist.
«Unsere Konzepte und Tools können Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern Orientierung und praktische Hilfe geben.»
Wann ist der richtige Zeitpunkt, um den Dialog zwischen Forschung und Praxis aufzunehmen?
A.S.: Der Prozess beginnt idealerweise mit einem Austausch darüber, wo die konkreten Fragen vor Ort liegen. Unsere Forschung ist in Module mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten gegliedert, doch alle arbeiten daran, Wissen zu erzeugen, um die Wechselwirkungen besser zu verstehen. Erst mit diesem Wissen kann man sinnvolle Entscheidungen für eine nachhaltige Gestaltung unseres Lebensraums treffen. Unsere Studierenden untersuchen zum Beispiel mit der Zürcher Verwaltung, wie sich technische Innovationen, Nachhaltigkeit und Planungsprozesse gegenseitig beeinflussen.
Ob neue Prozesse implementiert werden, entscheiden nicht wir – aber wir können helfen, sie anzustossen. Ein anderes Beispiel sind digitale Tools: Viele Module entwickeln innovative Werkzeuge, die zunehmend auch künstliche Intelligenz nutzen, etwa maschinelles Lernen. Solche Tools werden in der Praxis getestet und sollen es Ämtern und Büros ermöglichen, richtungsweisende Entscheidungen schneller und sicherer zu treffen. Wie bereits erwähnt, besteht das ultimative Ziel darin, dass unsere Erkenntnisse auch in die Ausarbeitung von Richtlinien oder Normen einfliessen.
Auch dafür gibt es Beispiele, gerade in Singapur.
Thomas Schröpfer: In Singapur sind Entscheidungsfindungen reaktiver als in der Schweiz. Einige unserer Ergebnisse wurden bereits in der Gesetzgebung berücksichtigt; wir beobachten gespannt, was sie bewirken. Umgekehrt sind die Behörden in Singapur stärker in unsere Forschung eingebunden als in der Schweiz, auch stärker als es in Deutschland oder den USA üblich wäre.
Wenn man in Singapur an einer Universität forscht, wissen die Behörden genau, was man tut, und melden sich mit Fragestellungen. In der Anfangsphase der Forschungsprogramme verständigt man sich über gemeinsame Ziele. Gleichzeitig sind die Behörden stolz auf das FCL: So wurden wir eingeladen, zusammen mit dem Ministry of National Development eine Fachveranstaltung zu organisieren, die parallel zum World Cities Summit stattfand, und eine Ausstellung in den Räumlichkeiten der wichtigsten Planungsbehörde, der Urban Redevelopment Authority, zu präsentieren.
Darüber hinaus gibt es in Singapur zunehmend Forschungsabteilungen in den Behörden selbst, die direkter an den praktischen Problemen der Behörden arbeiten als wir an den Universitäten. Hier ist die Abgrenzung besonders wichtig: Wir untersuchen Fragen, die über ein reines Problem Solving hinausgehen. Dies den Behörden zu vermitteln, ist nicht immer einfach.
«Wir richten den Blick weiter in die Zukuft und stellen übergeordnete Fragen.»
Warum ist es wichtig, dennoch auf die akademische Forschungsfreiheit zu bestehen?
T.S.: FCL kombiniert Grundlagen- und angewandte Forschung. Während Behörden praxisnah arbeiten, richten wir unseren Fokus auf langfristige, übergeordnete Fragen. Anhand konkreter Fallstudien betreten wir das Feld der angewandten Forschung, entwickeln innovative Methoden, analysieren urbane Dynamiken und erarbeiten übertragbare Erkenntnisse, die über lokale Herausforderungen hinausgehen und weltweit anwendbar sind.
A.S.: Die radikale Interdisziplinarität des FCL ist eine Stärke, die für Behörden schwierig ist, da sie primär ihre spezifischen Ziele verfolgen müssen. Das unterscheidet FCL auch von anderen Forschungsprogrammen. Als eines der weltweit wenigen Teams schaffen wir es, eine grosse thematische Breite abzudecken und trotzdem in die Tiefe zu gehen – auch, weil wir die kritische Masse dafür haben. Wir können Probleme aus verschiedenen Perspektiven betrachten und Synergien finden. Das ist einzigartig und notwendig: Das Denken in disziplinären Silos führt zu Zielkonflikten.
Gibt es auch einen Wissenstransfer über die Kontinente hinweg?
S.M.: Es ist gelungen, Planungsbehörden aus der Schweiz und Singapur zu einem Austausch anzuregen. Auch in unseren jährlichen Summer Courses und Workshops bringen wir Beteiligte aus aller Welt zusammen.
T.S.: Ein möglicher Wissenstransfer betrifft den Umgang mit urbanen Hitzeinseln, wie wir ihn im Projekt Cooling Singapur erforschen. Die Stadt zu kühlen, ist in Singapur seit jeher ein Problem. Nun werden auch Schweizer Städte zunehmend mit steigenden Temperaturen und extremen Niederschlägen konfrontiert; Themen wie Schwammstadt, Wohlbefinden im Aussenraum oder Biodiversität werden wichtiger.
«Können wir unsere Arbeit skalieren? Lassen sich unsere Tools auch anderswo anwenden?»
Inwiefern lassen sich Erkenntnisse aus Singapur auf Zürich übertragen – und umgekehrt?
A.S.: Umgekehrt weisen Schweizer Städte, die viele Jahrhunderte alt sind, eine grosse typologische Vielfalt auf. Das eröffnet Perspektiven. Durch die Notwendigkeit, unsere Bauten dem kalten Klima anzupassen, ist die Schweiz im Bereich der Material- und Bautechnologie konstruktiv und technisch in einer anderen Situation. Die in diesem Kontext gewonnenen Erfahrungen können auch für das Bauen in einem tropischen Klima hilfreich sein.
Und was sind die Ziele für die Zukunft?
A.S.: Im nächsten Programm öffnen wir den Fächer. Zürich und Singapur sind vergleichbar, doch es gibt noch ganz andere Siedlungsformen und Klimazonen. Diese haben wir ansatzweise schon adressiert, aber inwiefern können wir unsere Arbeit skalieren und unsere Erkenntnisse beispielsweise in Amsterdam, London, Toronto, Buenos Aires oder Mumbai anwenden?
T.S.: Wir nennen es Global Sandboxing: Wir wollen lernen, welche Erkenntnisse wie transferierbar sind. Lassen sich in einem bestimmten Kontext entwickelte digitale Tools auch anderswo anwenden? Funktionieren sie an Orten, wo es nur wenige Daten gibt? Handkehrum können wir heute viel grössere Datenmengen verarbeiten als früher.
S.M.: Was bleibt, ist der Antrieb des FCL-Forschungsprogramms: der Mensch. Er steht im Zentrum – sein Wohlbefinden und die Nachhaltigkeit seines Lebensraums.