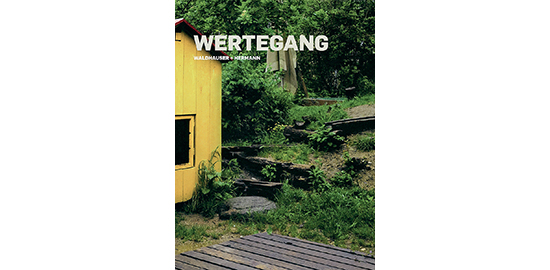Gebäudetechnik mit Werten
Verglichen mit Architekten und Bauingenieuren ist eine Monografie eines Gebäudetechnikbüros eher selten. Nun erschien mit «Wertegang 19732013» eine Publikation der Waldhauser + Hermann AG im Eigenverlag. Das Münchensteiner Unternehmen steht für methodisches Denken zur Energie- und Nachhaltigkeitsfrage.
Werner Waldhauser gründete 1973 gemeinsam mit seinem ehemaligen Lehrmeister Dieter Studer das Büro Studer + Waldhauser, Ingenieurbüro für Installationstechnik in Münchenstein BL. Dank Hochkonjunktur konnte das kleine Büro von Anfang an grössere Projekte bearbeiten wie die Umschlags AG in Basel und Schulhäuser im Kanton Aargau, 1985 trennten sich die Wege, und Werner Waldhauser gründete das Ingenieurbüro für Haustechnik. Der Generationenwechsel erfolgte 2008: Der Sohn Marco Waldhauser und Roman Hermann übernahmen die Firma (seit 1. Januar 2013 Waldhauser + Hermann AG). Die nun im Eigenverlag erschienene Monografie «Wertegang» dokumentiert über die Firmengeschichte hinaus eine Chronik der Energiegeschichte.
1973-1982: Ölkrise
Von Beginn an beschäftigte sich Werner Waldhauser mit Themen, die auch heute noch aktuell, jedoch immer noch nicht selbstverständlich sind, wie interdisziplinäres Denken und Arbeiten. Nach der Ölkrise waren Fragen wie Wärmerückgewinnung, Wärmepumpentechnologie und die Reduktion des Energieverbrauchs zu lösen. In dieser Phase entstand eine Zusammenarbeit mit der Brugger Planungsfirma Metron, die zu zukunftsgerichteten Konzepten führte. Die Energieplanung des Firmensitzes von Mikron Haesler in Boudry NE (1983) mit Fritz Hallers Baukastensystem führte zur Auseinandersetzung mit extremen Bedingungen reiner Glasbauten: «Mit Unterstützung eines programmierbaren HP-Rechners konnten wir damals mit einer dynamischen Wärmeverlust- und -gewinnBerechnung und einem Aufwand von ca. 120 Stunden nachweisen, dass der Energieverbrauch mit konventionellen Gebäuden absolut vergleichbar ist, was im späteren Betrieb bestätigt wurde.»1 Heutige Simulationsprogramme bewältigen das in wenigen Stunden.
1983-1992: Energiebewusstsein
Das wachsende Energiebewusstsein rund eine Dekade nach dem Erdölschock lenkte die Aufmerksamkeit auf weitere entwurfs- und konstruktionsrelevante Bereiche: Gebäudehülle, Raumklimazonen, natürliche Raumlüftung. Das Laborgebäude «K 135» von Andrea Roost in Basel (1983) bot Gelegenheit dazu, Raumgruppen mit unterschiedlichen Klimaszenarien voneinander abzugrenzen und so das Nutzungskonzept im Gebäudevolumen zu klären. Diese Zusammenarbeit war zukunftsweisend für weitere Projekte. Grundlegende Überlegungen zur natürlichen Belüftung im räumlich-konstruktiven Entwurf der Galerie für die Sammlung Goetz in München (1992; Herzog & de Meuron) wirkten modellhaft, beispielsweise für das spätere Museumsprovisorium von Gigon/Guyer in Winterthur (1995).
1993-2002: Labels statt Innovation
Inzwischen konnte sich Werner Waldhauser auf Erkenntnisse aus komplexen Bauvorhaben abstützen und kämpferisch auf die aufkommende Labeleuphorie reagieren. Dazu definierte er Maximen wie: «Je weniger Geld zur Verfügung steht, desto kreativer wird man und desto mehr profitiert man von einer risikobereiten Bauherrschaft» und «Hohe Anforderungen bedeuten nicht unbedingt hohen Technikeinsatz.» Eine Herausforderung bot die Energieplanung des Lehrerseminars Chur (1997; Bearth & Deplazes): ein vollverglastes Schulhaus ohne mechanische Lüftung oder Kühlung. Verglichen mit früheren Haller-Bauten waren bessere Glaseigenschaften verfügbar, die mit Sonnenschutzmassnahmen, Gebäudemasse und Lüftungsflügeln zu einem integrierten Gesamtsystem kombiniert werden konnten. Ganzjahressimulationen halfen, ein umwelt- und energiebewusstes Benutzerverhalten zu erlernen und permanent anzuwenden Mensch-Technik-Interaktion als modellhaftes Training angehender Lehrkräfte.
2003-2012: Umbruch
Bei vielen Projekten ging es dem Büro um das Durchsetzen von nicht Minergie-gerechten, aber energieeffizienten Lösungen. Werner Waldhauser ist überzeugt, dass unkritisches Einhalten und Nichthinterfragen von Vorgaben zu Denkblockaden sowie Innovations- und Motivationshemmnissen führen. Das Beispiel des Berufsbildungszentrums Baden von Burkhard Meyer Architekten (20022006) repräsentiert dies. Der Bau wurde 2006 mit der Auszeichnung «Umsicht Regards Sguardi» des SIA und mit dem «GebäudetechnikAward» gewürdigt. Eine bisher nicht publizierte Perle stellen die Wettbewerbsskizzen zur energetischen und ökologischen Bewirtschaftung des Laban Dance Centers in London-Greenwich dar (2003; Herzog & de Meuron): Alle verfügbaren natürlichen Ressourcen wie passive und aktive Solarenergie, Wasser des nahen Kanals, natürliches Grün und Umgebungsluft waren als Teil des Baus als Gesamtsystem einbezogen und in den typologischen Schnittzeichnungen abgebildet.
Ein Stück Zeitgeschichte
Neben vielen weiteren modellhaften Konzept- und Projektarbeiten bietet das Buch in der Randspalte eine konzise Parallelgeschichte: Sie dokumentiert, welche Ereignisse und Faktoren Werner Waldhauser und seine Mitstreiter beeinflusst haben. Den Abschluss bilden Bemerkungen zur Bedeutung der Lehrlingsausbildung, eine Auflistung von Waldhausers Auslandserfahrungen sowie eine Übersicht seiner Auszeichnungen, darunter der «Solarpreis 1993» für die Kantonsschule Solothurn (19921993, Fritz Haller).
Anmerkung
- Alle Zitate stammen aus der beschriebenen Publikation.